Wenn ich schon Werbung für die junge Welt mache, stelle ich meinen LeserInnen gleich noch folgenden ausführlichen Artikel zum Verhältnis zwischen DKP und Der Linken von meinem ehemaligen Professor Georg Fülberth als Beispiel der Qualität der kritischen Analyse und Diskussion, die diese Zeitung bietet, zur Verfügung. Eine Antwort auf Kritik von samizdata findet sich in den Kommentaren des Beitrags vom 17. März. Passend zum Thema ist heute die Dokumentation "Stecker gezogen" der jW-Podiumsdiskussion "Was treibt Die Linke? Funktion und Folgen eines Skandals" erschienen.
Linke Desillusionierung
Das konnte nicht gutgehen: Eine zutiefst antikommunistische Politiklandschaft, eine Linkspartei, die darin ankommen will, und eine DKP-Führung, die beste Freundin der Linkspartei sein will
Gratulation! In mehrfacher Hinsicht ist der Erfolg der Linkspartei bei der Landtagswahl in Niedersachsen der schönste. Erstens, weil sie dort in Prozenten am besten abgeschnitten hat. Ihr Fraktionsvorsitzender Manfred Sohn hat geschildert, wieviel Einsatz vor Ort dafür geleistet worden ist (siehe jW v. 10.3.2008). Zweitens hat die niedersächsische Linkspartei Grund zur Genugtuung, weil niemand ihr diesen Erfolg zugetraut hätte. Ende des vergangenen Jahres wurde ihr von ihrem Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch allenfalls ein Überraschungserfolg vorhergesagt. Drittens handelt es sich offenbar um einen vergleichsweise linken Landesverband. Der Landesvorsitzende Diether Dehm hat ihn klar profiliert.
Der vierte Grund zur Freude hat nun allerdings nichts mit den tatsächlich unübersehbaren Leistungen dieser Partei in Niedersachsen zu tun, sondern mit einer Konstellation, die dann auch zu ihren Gunsten wirkte. Anders als in Hessen und Hamburg gab es keine Polarisierung zwischen »Rot-grün« und »Schwarz-gelb«, die dort sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler in der Schlußphase des Wahlkampfs doch wieder ihrer eigenen Partei zugetrieben hat – wohl gerade auch die Linken unter ihnen, die mit der SPD schon seit langem fertig waren, jetzt aber ihr doch noch eine Chance geben wollten. Diese Bereitschaft zum Zusammenhalten, wenn es darauf ankommt, mag eine Sekundärtugend sein, ohne sie kommt eine Organisation aber nicht aus. Sie gehört – man kann da sogar von Solidarität sprechen – zu den angenehmeren sozialdemokratischen Traditionen. Seit Gerhard Schröder wird sie auf harte Proben gestellt, denn viele SPD-Anhänger merken, daß es noch etwas Wichtigeres gibt als die Treue zum Verein: nämlich die Ziele, deretwegen man immer zur Partei stand und die dort offenbar nicht mehr gut aufgehoben sind. In Niedersachsen zeigte sich, wie tief dieser Loyalitätskonflikt inzwischen ist.
Die Stimmabgabe für das sozialdemokratischere der beiden Angebote war dort keine Sabotage des Versuchs, die CDU-Regierung von Christian Wulff zu stürzen. In dieser Situation wurde sichtbar, wie tief der Riß im SPD-Potential inzwischen geworden war. Solange Kurt Becks Partei an Hartz IV und an der Rente mit 67 festhält, wird sich daran auch nichts ändern. Nur in zelebrierten Kopf-an-Kopf Rennen wie in Hessen kann da noch gekittet werden.
Grundsätzlich erweist sich am Phänomen der sozialdemokratischen Wechselwähler aber, was tatsächlich ansteht: die Notwendigkeit einer Umorientierung der SPD weg von der Agenda 2010. Das wird keine einfache Rückkehr zu den Verhältnissen vor Schröder mehr sein, sondern der Kampf um eine neue gesellschaftliche Konstellation. Gegenwärtig beginnt er als Richtungsstreit innerhalb der SPD. Insofern ist sie gegenwärtig – unabhängig vom Format ihres Personals – die interessanteste der deutschen Parlamentsparteien. Schafft sie eine Umorientierung nach links, wird das nicht ohne innere Kündigungen oder Absplitterungen an ihrem rechten Rand abgehen. Scheut sie davor zurück, wird Die Linke stärker. Aber auch, falls Becks Öffnungspolitik ehrlich und erfolgreich sein sollte, wird er die Konkurrenz so schnell nicht wieder los. Ein gesellschaftlicher Umbau hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit ist nicht mit einer einzigen sozialdemokratischen Partei zu stemmen, sondern allenfalls mit zweien.
Von der Absetzbewegung des linken Potentials in der SPD hat Die Linke in Niedersachsen profitiert. Das war dann tatsächlich das Glück des (oder der) Tüchtigen. Es ist auch anzunehmen, daß ihre Landtagsfraktion eine ausgezeichnete Oppositionspolitik machen wird. So weit, so gut.
Kosten-Nutzen-Rechnung
Zur Cleverneß der Linkspartei in Niedersachsen gehört auch die Art und Weise, wie die Landesliste vorbereitet wurde. Es galt zu verhindern, Stimmen an Konkurrenten zu verlieren, die vielleicht nur 0,1 oder 0,2 Prozent erhielten, die aber dann gerade dazu fehlen würden, daß man selbst die fünf Prozent schaffte. Größere Hoffnungen als auf knappes Erreichen des Landtags hatte man ja zunächst nicht. Also wollte man nicht, daß die Partei Die Grauen und die Deutsche Kommunistische Partei eigenständig kandidierten.
Das Verhalten der DKP kann man sich gut vorstellen. Es gibt da so einen gravitätischen Gestus, der auf die Nerven geht: von strategischer Allianz wird da geredet, von Augenhöhe, dem Wunsch nach regelmäßigen Konsultationen, Bündnis und derlei Einbildungen. Dieses Sich-selbst-zu-wichtig-Nehmen wird man wohl mit der Forderung nach einem sicheren Listenplatz verbunden haben. Daß Die Linke in dem letzten Punkt nicht mitmachte, hat fünf gute Gründe.
Erstens: Die Konkurrenz um die Spitzenpositionen ist dort ohnehin hart genug. Neue Bewerber sind da nicht willkommen, und die Garantie fester Plätze bedeutet Wettbewerbsverzerrung – für eine marktorientierte Partei eine Todsünde. Zweitens: Prominente Plazierung von Kommunisten könnte das auslösen, was man bei der Linkspartei am meisten fürchtet: ein Mediendesaster. Drittens: Die Linke ist – wie die DKP – eine Partei mit Vorsitzenden, Kassierern und Schriftführern, sie ist also keine Bewegung. Listenverbindungen sind schon durch das Wahlrecht verboten. Viertens: Durch Begünstigung von Kommunisten wären innerparteilich die dort durchaus vorhandenen schlafenden antikommunistischen Hunde geweckt worden. Fünftens: Die Linkspartei konnte sich eine schroffe Abweisung gut leisten. Gerade das staatsmännisch-verantwortungsbewußte Gehabe des Vorstands der DKP hindert die kommunistische Partei daran, in brenzligen Situationen selbständig anzutreten und damit sich als nicht »bündnisfähig« zu erweisen.
Also reichte es nur zu einem neunten Platz für das DKP-Mitglied Christel Wegner. Nach damaligem Ermessen galt diese Position als aussichtslos.
Aus Manfred Sohns Bericht (jW v. 10.3.2008) geht hervor, daß einigen Leuten in der Linkspartei selbst das schon zu weit ging. Es mag manche E-Mail in Niedersachsen und zwischen dem Karl-Liebknecht-Haus in Berlin und Hannover hin- und hergegangen sein. Am Ende siegte eine nüchterne Kosten-Nutzen-Rechnung: Christel Wegner wurde genau so plaziert, daß man die erwünschten 0,2 Prozent der DKP erhielt, aber (aufgrund der unauffälligen Position) Aufsehen vermieden wurde.
Ein Interview
Die Komplikation entstand ausgerechnet durch das überraschend gute Ergebnis. Christel Wegner wurde gewählt. Diether Dehm hat das offenbar gut gepaßt, denn er hat diese Abgeordnete auf einer Pressekonferenz offensiv präsentiert. Daß die Medien nur auf eine solche »Sensation« gewartet hatten, war abzusehen. Christel Wegner wurde von Mitgliedern ihrer Fraktion ausdrücklich ermutigt, Interviewbitten nicht aus dem Weg zu gehen. Offenbar hat aber niemand daran gedacht – weder in der DKP noch in Die Linke noch die Betroffene selbst – daß zumindest beim Umgang mit dem Fernsehen ganz schnell Professionalität antrainiert werden muß und bestimmte Regeln zu beherzigen sind: sich vorher festlegen, worüber man reden will und worüber nicht, zu Standardfragen Standardantworten bereithalten und notfalls auswendiggelernt wiederholen, Bereitschaft zum Abbruch. Weil diese Vorbereitung unterblieb, passierte das Malheur der »Panorama«-Sendung vom 14. Februar 2008.
Was Christel Wegner in dem zirka einstündigen Gespräch insgesamt gesagt hat, ist unbekannt. Es wurden nur Ausschnitte gebracht. Sie stimmen nicht mit dem überein, was unmittelbar nach der Ausstrahlung und insbesondere in schriftlichen Darlegungen (auch auf der Homepage von »Panorama«) behauptet worden ist. Es bleibt aber, daß Christel Wegner sich nicht an das hielt, was jeder politische Medienfuchs weiß: daß man nämlich selbst in einem längeren Gespräch niemals einen Satz sagen darf, der aus dem Zusammenhang gerissen und gegen den (oder die) Interviewte(n) gerichtet werden kann.
Halten wir uns an das, was im Fernsehen als O-Ton zu hören und zu sehen war, dann bleiben drei Aussagen stehen. Erstens: »Die Linke möchte mit Reformen Veränderungen erreichen und wir (gemeint war die DKP; G. F.) sind der Auffassung: Das reicht nicht. (…) Wir wollen den Umbau der Gesellschaft. (…) Die Macht des Kapitals kann nur dadurch überwunden werden, daß wir eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel bekommen.«
Als Forderung einer sozialistischen Politikerin ist das ja nun nichts Überraschendes. Es wird behauptet, daß auch in Die Linke solche Ansichten noch vertreten werden. Gregor Gysi aber findet das offenbar empörend. In derselben »Panorama«-Sendung äußerte er sich so: »Es gibt für uns keinen Weg zur Verstaatlichung aller Produktionsmittel.« Wir wollen auch hier medienkritisch sein. Die Absage an die »Verstaatlichung aller Produktionsmittel« – das hat Gysi tatsächlich gesagt. Aber wir wissen nicht, ob das eine unmittelbare Antwort auf Christel Wegner war oder ob es von der Redaktion in die Sendung hineingeschnitten wurde.
Die neugewählte Abgeordnete sagte zweitens: »Also jeder Staat versucht ja, sich sozusagen vor Angriffen von außen zu schützen.« Das soll sie auf die Mauer bezogen haben. Es ist nicht ganz klar, ob die Frage der Reporterin, die man hört, unmittelbar vor dieser Antwort gestellt wurde. Falls das so war, dann hätte Christel Wegner tatsächlich etwas Falsches gesagt. Die Mauer sollte das Abwandern von Arbeitskräften aus der DDR verhindern, nicht einen Angriff von außen.
Drittens. Zur Rolle von Geheimdiensten im Sozialismus: »Ich denke …, wenn man eine andere Gesellschaftsordnung errichtet, daß man da so ein Organ wieder braucht, weil man sich auch davor schützen muß, daß andere Kräfte, reaktionäre, die Gelegenheit nutzen und so einen Staat von innen aufweichen.« Der Fehler, den Christel Wegner hier beging, besteht darin, daß sie sich gleichsam auf geschichtsphilosophische Spekulationen darüber einließ, ob irgendwann in ferner Zukunft, wenn wieder einmal eine sozialistische Gesellschaft möglich sein sollte, diese einen Geheimdienst benötigen wird. Das weiß heute kein Mensch. Natürlich war es äußerst naiv, in einer Situation, in der nur auf einen verfänglichen Satz über die Staatssicherheit der DDR gewartet wurde, derartig daherzuphilosophieren.
Wer nach der Sendung Kontakt zu Christel Wegner aufnahm, erfuhr, daß sie nicht nur über die Wirkung des Interviews unglücklich war, sondern auch über ihre Ungeschicklichkeit. Während ihr Haus von Medienmenschen belagert wurde, die Bild-Zeitung Nachbarn Geld anbot und merkwürdigerweise sogar die Kripo bei Anwohnern Erkundigungen einzog, sortierte sie sich. Die Erklärungen, die sie danach abgab, zeigen, daß sie zu vernünftigen Einschätzungen gekommen ist: Selbstkritik ja, Weglaufen nein. Dazu braucht man halt ein paar Tage. Sie hat ihren Text aber noch rechtzeitig an ihre Fast-Fraktion gegeben, bevor diese die Trennung beschloß. Das wollte dort aber niemand mehr hören. Man war nämlich längst damit beschäftigt, die eigene Haut zu retten.
Wer wen?
So. Nachdem wir uns die Fakten angesehen haben, wollen wir – wie wir es gelernt haben – uns einmal ansehen, welche Akteure mit welchen Interessen hier am Werk sind.
Beginnen wir mit der »Panorama«-Sendung. Daß die Redaktion von vornherein, schon vor dem Interview, eine Kampagne arrangiert hatte, ist kein großes Jammern wert. Das ist in dieser Branche halt so. Pit Metz, ehemaliger Spitzenkandidat der Linkspartei in Hessen und ehemaliges DKP-Mitglied, hatte Ende August vorigen Jahres weniger Angriffsflächen geboten als Christel Wegner. Dennoch ist mit ihm dasselbe passiert. Ob die Redaktion nur die Wahl in Hamburg beeinflussen und Die Linke schädigen wollte, ist nicht ganz sicher. Die Moderatorin fand erkennbar Gregor Gysi recht nett und war einen Schulterschluß mit ihm und seiner Crew gegen die DKP ersichtlich zugeneigt.
Völlig verständlich ist, daß CDU/CSU, FDP, Grüne und SPD ihre Kettenhunde gegen die Linkspartei losließen und daß auch Bild und die gesamte konservative und rechts- wie linksliberale Presse viel zu sagen hatte: Die Linkspartei sei Mauer- und MfS-geneigt, denn es gebe da ja »Stasi-Christel«. Das war Wahlkampf.
Damit kommen wir zu einem dritten Akteur: dem Personal an der Spitze der Linkspartei. Indem man sofort verbal zuschlug, wollte man einerseits einen Einbruch in Hamburg verhindern, andererseits ein wichtigeres Projekt vorantreiben: Bereinigung im Inneren. Das dürfte gelingen. Das »Forum demokratischer Sozialismus« wird es, was ohnehin geschehen wäre, beschleunigen können.
Viertens: die Landtagsfraktion in Hannover. Sie fürchtete, für Verluste in Hamburg verantwortlich zu sein und inszenierte einen Ausschluß, der formal gar keiner sein konnte. Laut Geschäftsordnung des Landtags können nur Mitglieder einer Partei, deren Liste gewählt wurde, ihrer Fraktion angehören. Christel Wegner, DKP, hätte allenfalls Gaststatus bekommen können. Man begnügte sich nicht damit, ihr diesen zu verweigern, sondern zeigte einen öffentlichen Exorzismus vor.
Für dieses hundertfünfzigprozentige Verhalten gibt es neben der Wahltaktik für Hamburg einen zweiten Grund: Diether Dehm ist im Karl-Liebknecht-Haus nicht wohlgelitten. Dort hat man gegen ihn inzwischen junge, aufstiegswillige Freunde in Niedersachsen gewonnen. In der FAZ wurde nach der Interviewaffäre denn auch darüber spekuliert, wann Dehm gestürzt werde. Prognose: Es werde noch ein wenig dauern. Das Wegner-Bashing soll die Gnadenfrist verlängern.
Nachdem die Interessen einiger Akteure – Medien, CDU/CSU/FDP/Grüne/Berliner Parteiführung sowie die niedersächsische Landesorganisation – erläutert sind, soll noch auf folgende Merkwürdigkeit hingewiesen werden: Alle drei benutzten dasselbe aufgeheizte Vokabular. Die Mandatsträger der Linkspartei unterschieden sich nicht von den Bürgerlichen.
Hierzu eine historische Reminiszenz: Als sich in den sechziger Jahren die Neue Linke um den SDS auf den Weg machte, interessierte sie sich sehr für die gesellschaftliche Macht der Bewußtseinsindustrie: »Enteignet Springer!« Als daraus nichts wurde, folgte im Laufe der Zeit eine Art negativer Lernprozeß. Man erfuhr, daß der medial-ökonomisch-politische Komplex nicht zu besiegen sei, sondern daß man, wollte man erfolgreich sein, zu seinen Bedingungen arbeiten müsse. So entstand das Produkt Joseph Fischer.
Die Partei Die Linke hat diesen Lernprozeß nicht etwa nachgeholt, sondern sie begann da, wo die anderen inzwischen längst angekommen waren. Sie ist die medien-ängstlichste und am meisten an Fernsehen und Großpresse angepaßte Partei der Bundesrepublik. Innerparteilich wirkt sich das so aus, daß sie mehr als andere Organisationen an Führungsfiguren orientiert ist, mit inzwischen sichtbar werdenden Folgen für die innerparteiliche Demokratie.
Wir sehen, wie aufklärend der angebliche »Fall Wegner« ist. Er ist ein Fall »Die Linke«.
DKP – Stecker raus!
Je länger das »Panorama«-Interview Christel Wegners zurückliegt, desto mehr zeigt sich, daß es durchaus sein Gutes hatte. Es hat einen Prozeß forciert, der ohnehin überfällig war: (hoffentlich) die Trennung der DKP von Die Linke. Die wird zur Zeit ja vor allem von Gysi, Ramelow und Lafontaine betrieben. Doch auch wer – anders als sie – nicht ankommen oder ins alte Geschäft zurück will, hat Anlaß, Distanz zu suchen, und zwar zu ihnen.
Wenn in der Vergangenheit Mitglieder der DKP auf Listen der PDS, dann der Linkspartei.PDS und zuletzt der Partei Die Linke kandidiert haben, dann nicht, weil sie in den Bundestag oder einen Landtag wollten, sondern weil sie solidarische Rindviecher waren. Der Verfasser der hier vorliegenden bescheidenen Zeilen – Platz 14 auf der hessischen Bundestags-Landesliste 2005 – weiß, wovon er redet. Selbst damals noch, als das Hauen und Stechen um die aussichtsreichen vorderen Plätze in vollem Gang war, wurde noch um ein bißchen Import auf den hinteren Rängen geworben. Niemand rechnete damit, daß die Kandidaten aus der DKP einen Sitz erhalten würden, auch sie selber nicht.
Manfred Sohn hat, wie gezeigt, Unrecht mit seiner Behauptung, man habe Christel Wegner einen »hervorragenden Platz« eingeräumt. Ach was! Es war die übliche verschämte Besenkammerposition, aus der lediglich aufgrund eines unerwarteten und dann tatsächlich hervorragenden Wahlergebnisses etwas wurde. In Hessen war das übrigens der ebenso verborgene Platz elf für eine DKP-Genossin, die sogar ohne ausdrückliche Ermutigung ihres Landesvorstandes sich bitten ließ. Bei einem vorzüglichen Ergebnis wie in Niedersachsen wäre es dann zum selben Klamauk gekommen – mit Interview oder ohne.
Mit solchen Dienstleistungen sollte jetzt aber wirklich Schluß sein. Manfred Sohn hat nämlich in dem einen Punkt recht, »daß man Räume, die man beansprucht, auch ausfüllen können muß«. Das kann die DKP auf Bundes- und Länderebene zur Zeit nicht (Stadtstaaten vielleicht ausgenommen). Sie sollte deshalb auch nicht bei anderen unterschlüpfen, sondern entweder auf Kandidaturen verzichten oder selbständig antreten, wenn sie eine Chance hat, thematisch neben der Partei Die Linke sichtbar zu werden.
In den Kommunen sieht das nur auf den ersten Blick anders aus. Sie sind von altersher das Feld von Wählergemeinschaften und überparteilichen Hybridgebilden. DKP-Mitglieder haben dort auf Listen der Linkspartei Mandate. Sie werden nach wie vor ihre Arbeit in der Zeit tun, für die sie gewählt wurden. Danach sollten sie meiner Meinung nach wieder selbständig für ihre eigene Partei kandidieren. Diese »Räume« füllen sie nämlich aus. Es gibt in den Gemeinden fast nirgends noch die Fünf-Prozent-Klausel. Wo kumuliert, gestrichen und panaschiert (Stimmenhäufung für einzelne Kandidaten, Querwahl zwischen den Listen) wird, können sich überdies interessante Effekte ergeben.
Für das Verhältnis der DKP zur Linkspartei sollte aber künftig gelten: Stecker raus!
Viel Glück, Christel Wegner!
Aber das sind Überlegungen zwar für bald, aber erst einmal für später. Jetzt gilt: Christel Wegner ist gewählte Abgeordnete. Sie hat erklärt, daß sie sich im Landtag an das Wahlprogramm der Linkspartei halten wird. Die Fraktion, die sie als Gast hätte aufnehmen können, hat sie nicht verlassen, sondern sie wurde weggeschickt. Deshalb ist die Forderung, sie solle ihr Mandat zurückgeben, gelinde gesagt, merkwürdig. Als man sie »ausschloß«, hat man den Verlust dieses Sitzes wohl billigend in Kauf genommen: Man hat ja jetzt recht viele.
Christel Wegner arbeitete 22 Jahre als Krankenschwester und später als Pflegedienstleiterin, sie war Personalratsvorsitzende einer Klinik. Mit beratender Stimme gehört sie dem Ausschuß für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit an. Der niedersächsische Landtag dürfte nicht viele Mitglieder haben, die aufgrund derart langer eigener Berufstätigkeit so viel Kompetenz in diesen Bereichen mitbringen. Christel Wegner hat nach ihrem »Panorama«-Unfall schnell gelernt, wie man es schafft, sich von den Medien nicht ein zweites Mal hereinlegen zu lassen. Irgendwann wird sie im Landtag auch reden. Sie wird ihre Beiträge gut vorbereiten, sie gewiß schriftlich mitbringen (andere tun das auch), Wort für Wort vortragen, sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, und nach einiger Zeit werden zumindest einiger derer, die sie ausschließlich unter ihrem »Panorama«-Interview abbuchen wollten, merken, daß sie auf einem ganz anderen Gebiet ziemlich viel zu sagen hat. Wer ihr zu ihrer neuen Tätigkeit Glück wünscht, wird also absehbar damit erfolgreich sein.
Eine Benimmregel
Als Manfred Sohn vor Jahren die DKP verließ, gab es dafür einen plausiblen Grund: Mit dieser geschrumpften Partei ließ sich die offensive linksradikale Politik, deren überzeugender Vertreter er damals war, nicht machen. Jetzt ist er in Die Linke, und da geht das ebensowenig. Sie ist zwar nicht kaputt, scheut aber linke Radikalität. Wer in ihrem Rahmen Politik macht, muß sich, war er einmal anders, zurücknehmen. Das ist begreiflich und keineswegs verwerflich. Es gibt aber Stilfragen. Sie stellen sich immer, wenn die Auseinandersetzung mit früheren Genossinnen und Genossen geführt wird. Ein gewisser Tonfall verbietet sich da auf beiden Seiten.
Erschienen in der jungen Welt vom 14.03.2008, Seite 10.
Von Georg Fülberth erscheint im April das Buch: "Doch wenn sich die Dinge ändern." Die Linke, PapyRossa Verlag, Köln, 160 Seiten, 12,90 €.
Linke Desillusionierung
Das konnte nicht gutgehen: Eine zutiefst antikommunistische Politiklandschaft, eine Linkspartei, die darin ankommen will, und eine DKP-Führung, die beste Freundin der Linkspartei sein will
Gratulation! In mehrfacher Hinsicht ist der Erfolg der Linkspartei bei der Landtagswahl in Niedersachsen der schönste. Erstens, weil sie dort in Prozenten am besten abgeschnitten hat. Ihr Fraktionsvorsitzender Manfred Sohn hat geschildert, wieviel Einsatz vor Ort dafür geleistet worden ist (siehe jW v. 10.3.2008). Zweitens hat die niedersächsische Linkspartei Grund zur Genugtuung, weil niemand ihr diesen Erfolg zugetraut hätte. Ende des vergangenen Jahres wurde ihr von ihrem Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch allenfalls ein Überraschungserfolg vorhergesagt. Drittens handelt es sich offenbar um einen vergleichsweise linken Landesverband. Der Landesvorsitzende Diether Dehm hat ihn klar profiliert.
Der vierte Grund zur Freude hat nun allerdings nichts mit den tatsächlich unübersehbaren Leistungen dieser Partei in Niedersachsen zu tun, sondern mit einer Konstellation, die dann auch zu ihren Gunsten wirkte. Anders als in Hessen und Hamburg gab es keine Polarisierung zwischen »Rot-grün« und »Schwarz-gelb«, die dort sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler in der Schlußphase des Wahlkampfs doch wieder ihrer eigenen Partei zugetrieben hat – wohl gerade auch die Linken unter ihnen, die mit der SPD schon seit langem fertig waren, jetzt aber ihr doch noch eine Chance geben wollten. Diese Bereitschaft zum Zusammenhalten, wenn es darauf ankommt, mag eine Sekundärtugend sein, ohne sie kommt eine Organisation aber nicht aus. Sie gehört – man kann da sogar von Solidarität sprechen – zu den angenehmeren sozialdemokratischen Traditionen. Seit Gerhard Schröder wird sie auf harte Proben gestellt, denn viele SPD-Anhänger merken, daß es noch etwas Wichtigeres gibt als die Treue zum Verein: nämlich die Ziele, deretwegen man immer zur Partei stand und die dort offenbar nicht mehr gut aufgehoben sind. In Niedersachsen zeigte sich, wie tief dieser Loyalitätskonflikt inzwischen ist.
Die Stimmabgabe für das sozialdemokratischere der beiden Angebote war dort keine Sabotage des Versuchs, die CDU-Regierung von Christian Wulff zu stürzen. In dieser Situation wurde sichtbar, wie tief der Riß im SPD-Potential inzwischen geworden war. Solange Kurt Becks Partei an Hartz IV und an der Rente mit 67 festhält, wird sich daran auch nichts ändern. Nur in zelebrierten Kopf-an-Kopf Rennen wie in Hessen kann da noch gekittet werden.
Grundsätzlich erweist sich am Phänomen der sozialdemokratischen Wechselwähler aber, was tatsächlich ansteht: die Notwendigkeit einer Umorientierung der SPD weg von der Agenda 2010. Das wird keine einfache Rückkehr zu den Verhältnissen vor Schröder mehr sein, sondern der Kampf um eine neue gesellschaftliche Konstellation. Gegenwärtig beginnt er als Richtungsstreit innerhalb der SPD. Insofern ist sie gegenwärtig – unabhängig vom Format ihres Personals – die interessanteste der deutschen Parlamentsparteien. Schafft sie eine Umorientierung nach links, wird das nicht ohne innere Kündigungen oder Absplitterungen an ihrem rechten Rand abgehen. Scheut sie davor zurück, wird Die Linke stärker. Aber auch, falls Becks Öffnungspolitik ehrlich und erfolgreich sein sollte, wird er die Konkurrenz so schnell nicht wieder los. Ein gesellschaftlicher Umbau hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit ist nicht mit einer einzigen sozialdemokratischen Partei zu stemmen, sondern allenfalls mit zweien.
Von der Absetzbewegung des linken Potentials in der SPD hat Die Linke in Niedersachsen profitiert. Das war dann tatsächlich das Glück des (oder der) Tüchtigen. Es ist auch anzunehmen, daß ihre Landtagsfraktion eine ausgezeichnete Oppositionspolitik machen wird. So weit, so gut.
Kosten-Nutzen-Rechnung
Zur Cleverneß der Linkspartei in Niedersachsen gehört auch die Art und Weise, wie die Landesliste vorbereitet wurde. Es galt zu verhindern, Stimmen an Konkurrenten zu verlieren, die vielleicht nur 0,1 oder 0,2 Prozent erhielten, die aber dann gerade dazu fehlen würden, daß man selbst die fünf Prozent schaffte. Größere Hoffnungen als auf knappes Erreichen des Landtags hatte man ja zunächst nicht. Also wollte man nicht, daß die Partei Die Grauen und die Deutsche Kommunistische Partei eigenständig kandidierten.
Das Verhalten der DKP kann man sich gut vorstellen. Es gibt da so einen gravitätischen Gestus, der auf die Nerven geht: von strategischer Allianz wird da geredet, von Augenhöhe, dem Wunsch nach regelmäßigen Konsultationen, Bündnis und derlei Einbildungen. Dieses Sich-selbst-zu-wichtig-Nehmen wird man wohl mit der Forderung nach einem sicheren Listenplatz verbunden haben. Daß Die Linke in dem letzten Punkt nicht mitmachte, hat fünf gute Gründe.
Erstens: Die Konkurrenz um die Spitzenpositionen ist dort ohnehin hart genug. Neue Bewerber sind da nicht willkommen, und die Garantie fester Plätze bedeutet Wettbewerbsverzerrung – für eine marktorientierte Partei eine Todsünde. Zweitens: Prominente Plazierung von Kommunisten könnte das auslösen, was man bei der Linkspartei am meisten fürchtet: ein Mediendesaster. Drittens: Die Linke ist – wie die DKP – eine Partei mit Vorsitzenden, Kassierern und Schriftführern, sie ist also keine Bewegung. Listenverbindungen sind schon durch das Wahlrecht verboten. Viertens: Durch Begünstigung von Kommunisten wären innerparteilich die dort durchaus vorhandenen schlafenden antikommunistischen Hunde geweckt worden. Fünftens: Die Linkspartei konnte sich eine schroffe Abweisung gut leisten. Gerade das staatsmännisch-verantwortungsbewußte Gehabe des Vorstands der DKP hindert die kommunistische Partei daran, in brenzligen Situationen selbständig anzutreten und damit sich als nicht »bündnisfähig« zu erweisen.
Also reichte es nur zu einem neunten Platz für das DKP-Mitglied Christel Wegner. Nach damaligem Ermessen galt diese Position als aussichtslos.
Aus Manfred Sohns Bericht (jW v. 10.3.2008) geht hervor, daß einigen Leuten in der Linkspartei selbst das schon zu weit ging. Es mag manche E-Mail in Niedersachsen und zwischen dem Karl-Liebknecht-Haus in Berlin und Hannover hin- und hergegangen sein. Am Ende siegte eine nüchterne Kosten-Nutzen-Rechnung: Christel Wegner wurde genau so plaziert, daß man die erwünschten 0,2 Prozent der DKP erhielt, aber (aufgrund der unauffälligen Position) Aufsehen vermieden wurde.
Ein Interview
Die Komplikation entstand ausgerechnet durch das überraschend gute Ergebnis. Christel Wegner wurde gewählt. Diether Dehm hat das offenbar gut gepaßt, denn er hat diese Abgeordnete auf einer Pressekonferenz offensiv präsentiert. Daß die Medien nur auf eine solche »Sensation« gewartet hatten, war abzusehen. Christel Wegner wurde von Mitgliedern ihrer Fraktion ausdrücklich ermutigt, Interviewbitten nicht aus dem Weg zu gehen. Offenbar hat aber niemand daran gedacht – weder in der DKP noch in Die Linke noch die Betroffene selbst – daß zumindest beim Umgang mit dem Fernsehen ganz schnell Professionalität antrainiert werden muß und bestimmte Regeln zu beherzigen sind: sich vorher festlegen, worüber man reden will und worüber nicht, zu Standardfragen Standardantworten bereithalten und notfalls auswendiggelernt wiederholen, Bereitschaft zum Abbruch. Weil diese Vorbereitung unterblieb, passierte das Malheur der »Panorama«-Sendung vom 14. Februar 2008.
Was Christel Wegner in dem zirka einstündigen Gespräch insgesamt gesagt hat, ist unbekannt. Es wurden nur Ausschnitte gebracht. Sie stimmen nicht mit dem überein, was unmittelbar nach der Ausstrahlung und insbesondere in schriftlichen Darlegungen (auch auf der Homepage von »Panorama«) behauptet worden ist. Es bleibt aber, daß Christel Wegner sich nicht an das hielt, was jeder politische Medienfuchs weiß: daß man nämlich selbst in einem längeren Gespräch niemals einen Satz sagen darf, der aus dem Zusammenhang gerissen und gegen den (oder die) Interviewte(n) gerichtet werden kann.
Halten wir uns an das, was im Fernsehen als O-Ton zu hören und zu sehen war, dann bleiben drei Aussagen stehen. Erstens: »Die Linke möchte mit Reformen Veränderungen erreichen und wir (gemeint war die DKP; G. F.) sind der Auffassung: Das reicht nicht. (…) Wir wollen den Umbau der Gesellschaft. (…) Die Macht des Kapitals kann nur dadurch überwunden werden, daß wir eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel bekommen.«
Als Forderung einer sozialistischen Politikerin ist das ja nun nichts Überraschendes. Es wird behauptet, daß auch in Die Linke solche Ansichten noch vertreten werden. Gregor Gysi aber findet das offenbar empörend. In derselben »Panorama«-Sendung äußerte er sich so: »Es gibt für uns keinen Weg zur Verstaatlichung aller Produktionsmittel.« Wir wollen auch hier medienkritisch sein. Die Absage an die »Verstaatlichung aller Produktionsmittel« – das hat Gysi tatsächlich gesagt. Aber wir wissen nicht, ob das eine unmittelbare Antwort auf Christel Wegner war oder ob es von der Redaktion in die Sendung hineingeschnitten wurde.
Die neugewählte Abgeordnete sagte zweitens: »Also jeder Staat versucht ja, sich sozusagen vor Angriffen von außen zu schützen.« Das soll sie auf die Mauer bezogen haben. Es ist nicht ganz klar, ob die Frage der Reporterin, die man hört, unmittelbar vor dieser Antwort gestellt wurde. Falls das so war, dann hätte Christel Wegner tatsächlich etwas Falsches gesagt. Die Mauer sollte das Abwandern von Arbeitskräften aus der DDR verhindern, nicht einen Angriff von außen.
Drittens. Zur Rolle von Geheimdiensten im Sozialismus: »Ich denke …, wenn man eine andere Gesellschaftsordnung errichtet, daß man da so ein Organ wieder braucht, weil man sich auch davor schützen muß, daß andere Kräfte, reaktionäre, die Gelegenheit nutzen und so einen Staat von innen aufweichen.« Der Fehler, den Christel Wegner hier beging, besteht darin, daß sie sich gleichsam auf geschichtsphilosophische Spekulationen darüber einließ, ob irgendwann in ferner Zukunft, wenn wieder einmal eine sozialistische Gesellschaft möglich sein sollte, diese einen Geheimdienst benötigen wird. Das weiß heute kein Mensch. Natürlich war es äußerst naiv, in einer Situation, in der nur auf einen verfänglichen Satz über die Staatssicherheit der DDR gewartet wurde, derartig daherzuphilosophieren.
Wer nach der Sendung Kontakt zu Christel Wegner aufnahm, erfuhr, daß sie nicht nur über die Wirkung des Interviews unglücklich war, sondern auch über ihre Ungeschicklichkeit. Während ihr Haus von Medienmenschen belagert wurde, die Bild-Zeitung Nachbarn Geld anbot und merkwürdigerweise sogar die Kripo bei Anwohnern Erkundigungen einzog, sortierte sie sich. Die Erklärungen, die sie danach abgab, zeigen, daß sie zu vernünftigen Einschätzungen gekommen ist: Selbstkritik ja, Weglaufen nein. Dazu braucht man halt ein paar Tage. Sie hat ihren Text aber noch rechtzeitig an ihre Fast-Fraktion gegeben, bevor diese die Trennung beschloß. Das wollte dort aber niemand mehr hören. Man war nämlich längst damit beschäftigt, die eigene Haut zu retten.
Wer wen?
So. Nachdem wir uns die Fakten angesehen haben, wollen wir – wie wir es gelernt haben – uns einmal ansehen, welche Akteure mit welchen Interessen hier am Werk sind.
Beginnen wir mit der »Panorama«-Sendung. Daß die Redaktion von vornherein, schon vor dem Interview, eine Kampagne arrangiert hatte, ist kein großes Jammern wert. Das ist in dieser Branche halt so. Pit Metz, ehemaliger Spitzenkandidat der Linkspartei in Hessen und ehemaliges DKP-Mitglied, hatte Ende August vorigen Jahres weniger Angriffsflächen geboten als Christel Wegner. Dennoch ist mit ihm dasselbe passiert. Ob die Redaktion nur die Wahl in Hamburg beeinflussen und Die Linke schädigen wollte, ist nicht ganz sicher. Die Moderatorin fand erkennbar Gregor Gysi recht nett und war einen Schulterschluß mit ihm und seiner Crew gegen die DKP ersichtlich zugeneigt.
Völlig verständlich ist, daß CDU/CSU, FDP, Grüne und SPD ihre Kettenhunde gegen die Linkspartei losließen und daß auch Bild und die gesamte konservative und rechts- wie linksliberale Presse viel zu sagen hatte: Die Linkspartei sei Mauer- und MfS-geneigt, denn es gebe da ja »Stasi-Christel«. Das war Wahlkampf.
Damit kommen wir zu einem dritten Akteur: dem Personal an der Spitze der Linkspartei. Indem man sofort verbal zuschlug, wollte man einerseits einen Einbruch in Hamburg verhindern, andererseits ein wichtigeres Projekt vorantreiben: Bereinigung im Inneren. Das dürfte gelingen. Das »Forum demokratischer Sozialismus« wird es, was ohnehin geschehen wäre, beschleunigen können.
Viertens: die Landtagsfraktion in Hannover. Sie fürchtete, für Verluste in Hamburg verantwortlich zu sein und inszenierte einen Ausschluß, der formal gar keiner sein konnte. Laut Geschäftsordnung des Landtags können nur Mitglieder einer Partei, deren Liste gewählt wurde, ihrer Fraktion angehören. Christel Wegner, DKP, hätte allenfalls Gaststatus bekommen können. Man begnügte sich nicht damit, ihr diesen zu verweigern, sondern zeigte einen öffentlichen Exorzismus vor.
Für dieses hundertfünfzigprozentige Verhalten gibt es neben der Wahltaktik für Hamburg einen zweiten Grund: Diether Dehm ist im Karl-Liebknecht-Haus nicht wohlgelitten. Dort hat man gegen ihn inzwischen junge, aufstiegswillige Freunde in Niedersachsen gewonnen. In der FAZ wurde nach der Interviewaffäre denn auch darüber spekuliert, wann Dehm gestürzt werde. Prognose: Es werde noch ein wenig dauern. Das Wegner-Bashing soll die Gnadenfrist verlängern.
Nachdem die Interessen einiger Akteure – Medien, CDU/CSU/FDP/Grüne/Berliner Parteiführung sowie die niedersächsische Landesorganisation – erläutert sind, soll noch auf folgende Merkwürdigkeit hingewiesen werden: Alle drei benutzten dasselbe aufgeheizte Vokabular. Die Mandatsträger der Linkspartei unterschieden sich nicht von den Bürgerlichen.
Hierzu eine historische Reminiszenz: Als sich in den sechziger Jahren die Neue Linke um den SDS auf den Weg machte, interessierte sie sich sehr für die gesellschaftliche Macht der Bewußtseinsindustrie: »Enteignet Springer!« Als daraus nichts wurde, folgte im Laufe der Zeit eine Art negativer Lernprozeß. Man erfuhr, daß der medial-ökonomisch-politische Komplex nicht zu besiegen sei, sondern daß man, wollte man erfolgreich sein, zu seinen Bedingungen arbeiten müsse. So entstand das Produkt Joseph Fischer.
Die Partei Die Linke hat diesen Lernprozeß nicht etwa nachgeholt, sondern sie begann da, wo die anderen inzwischen längst angekommen waren. Sie ist die medien-ängstlichste und am meisten an Fernsehen und Großpresse angepaßte Partei der Bundesrepublik. Innerparteilich wirkt sich das so aus, daß sie mehr als andere Organisationen an Führungsfiguren orientiert ist, mit inzwischen sichtbar werdenden Folgen für die innerparteiliche Demokratie.
Wir sehen, wie aufklärend der angebliche »Fall Wegner« ist. Er ist ein Fall »Die Linke«.
DKP – Stecker raus!
Je länger das »Panorama«-Interview Christel Wegners zurückliegt, desto mehr zeigt sich, daß es durchaus sein Gutes hatte. Es hat einen Prozeß forciert, der ohnehin überfällig war: (hoffentlich) die Trennung der DKP von Die Linke. Die wird zur Zeit ja vor allem von Gysi, Ramelow und Lafontaine betrieben. Doch auch wer – anders als sie – nicht ankommen oder ins alte Geschäft zurück will, hat Anlaß, Distanz zu suchen, und zwar zu ihnen.
Wenn in der Vergangenheit Mitglieder der DKP auf Listen der PDS, dann der Linkspartei.PDS und zuletzt der Partei Die Linke kandidiert haben, dann nicht, weil sie in den Bundestag oder einen Landtag wollten, sondern weil sie solidarische Rindviecher waren. Der Verfasser der hier vorliegenden bescheidenen Zeilen – Platz 14 auf der hessischen Bundestags-Landesliste 2005 – weiß, wovon er redet. Selbst damals noch, als das Hauen und Stechen um die aussichtsreichen vorderen Plätze in vollem Gang war, wurde noch um ein bißchen Import auf den hinteren Rängen geworben. Niemand rechnete damit, daß die Kandidaten aus der DKP einen Sitz erhalten würden, auch sie selber nicht.
Manfred Sohn hat, wie gezeigt, Unrecht mit seiner Behauptung, man habe Christel Wegner einen »hervorragenden Platz« eingeräumt. Ach was! Es war die übliche verschämte Besenkammerposition, aus der lediglich aufgrund eines unerwarteten und dann tatsächlich hervorragenden Wahlergebnisses etwas wurde. In Hessen war das übrigens der ebenso verborgene Platz elf für eine DKP-Genossin, die sogar ohne ausdrückliche Ermutigung ihres Landesvorstandes sich bitten ließ. Bei einem vorzüglichen Ergebnis wie in Niedersachsen wäre es dann zum selben Klamauk gekommen – mit Interview oder ohne.
Mit solchen Dienstleistungen sollte jetzt aber wirklich Schluß sein. Manfred Sohn hat nämlich in dem einen Punkt recht, »daß man Räume, die man beansprucht, auch ausfüllen können muß«. Das kann die DKP auf Bundes- und Länderebene zur Zeit nicht (Stadtstaaten vielleicht ausgenommen). Sie sollte deshalb auch nicht bei anderen unterschlüpfen, sondern entweder auf Kandidaturen verzichten oder selbständig antreten, wenn sie eine Chance hat, thematisch neben der Partei Die Linke sichtbar zu werden.
In den Kommunen sieht das nur auf den ersten Blick anders aus. Sie sind von altersher das Feld von Wählergemeinschaften und überparteilichen Hybridgebilden. DKP-Mitglieder haben dort auf Listen der Linkspartei Mandate. Sie werden nach wie vor ihre Arbeit in der Zeit tun, für die sie gewählt wurden. Danach sollten sie meiner Meinung nach wieder selbständig für ihre eigene Partei kandidieren. Diese »Räume« füllen sie nämlich aus. Es gibt in den Gemeinden fast nirgends noch die Fünf-Prozent-Klausel. Wo kumuliert, gestrichen und panaschiert (Stimmenhäufung für einzelne Kandidaten, Querwahl zwischen den Listen) wird, können sich überdies interessante Effekte ergeben.
Für das Verhältnis der DKP zur Linkspartei sollte aber künftig gelten: Stecker raus!
Viel Glück, Christel Wegner!
Aber das sind Überlegungen zwar für bald, aber erst einmal für später. Jetzt gilt: Christel Wegner ist gewählte Abgeordnete. Sie hat erklärt, daß sie sich im Landtag an das Wahlprogramm der Linkspartei halten wird. Die Fraktion, die sie als Gast hätte aufnehmen können, hat sie nicht verlassen, sondern sie wurde weggeschickt. Deshalb ist die Forderung, sie solle ihr Mandat zurückgeben, gelinde gesagt, merkwürdig. Als man sie »ausschloß«, hat man den Verlust dieses Sitzes wohl billigend in Kauf genommen: Man hat ja jetzt recht viele.
Christel Wegner arbeitete 22 Jahre als Krankenschwester und später als Pflegedienstleiterin, sie war Personalratsvorsitzende einer Klinik. Mit beratender Stimme gehört sie dem Ausschuß für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit an. Der niedersächsische Landtag dürfte nicht viele Mitglieder haben, die aufgrund derart langer eigener Berufstätigkeit so viel Kompetenz in diesen Bereichen mitbringen. Christel Wegner hat nach ihrem »Panorama«-Unfall schnell gelernt, wie man es schafft, sich von den Medien nicht ein zweites Mal hereinlegen zu lassen. Irgendwann wird sie im Landtag auch reden. Sie wird ihre Beiträge gut vorbereiten, sie gewiß schriftlich mitbringen (andere tun das auch), Wort für Wort vortragen, sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, und nach einiger Zeit werden zumindest einiger derer, die sie ausschließlich unter ihrem »Panorama«-Interview abbuchen wollten, merken, daß sie auf einem ganz anderen Gebiet ziemlich viel zu sagen hat. Wer ihr zu ihrer neuen Tätigkeit Glück wünscht, wird also absehbar damit erfolgreich sein.
Eine Benimmregel
Als Manfred Sohn vor Jahren die DKP verließ, gab es dafür einen plausiblen Grund: Mit dieser geschrumpften Partei ließ sich die offensive linksradikale Politik, deren überzeugender Vertreter er damals war, nicht machen. Jetzt ist er in Die Linke, und da geht das ebensowenig. Sie ist zwar nicht kaputt, scheut aber linke Radikalität. Wer in ihrem Rahmen Politik macht, muß sich, war er einmal anders, zurücknehmen. Das ist begreiflich und keineswegs verwerflich. Es gibt aber Stilfragen. Sie stellen sich immer, wenn die Auseinandersetzung mit früheren Genossinnen und Genossen geführt wird. Ein gewisser Tonfall verbietet sich da auf beiden Seiten.
Erschienen in der jungen Welt vom 14.03.2008, Seite 10.
Von Georg Fülberth erscheint im April das Buch: "Doch wenn sich die Dinge ändern." Die Linke, PapyRossa Verlag, Köln, 160 Seiten, 12,90 €.





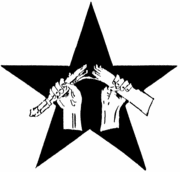


2 Kommentare:
Die Deutsche Leitkultur zieht sich in Hamburg aus und wird nun von Multikultis gevögelt. Lass uns dieses Porno mit Freude zugucken.
www.vaterlandslose-gesellen.de
Willst du damit sagen, dass die Grünen in Hamburg sich in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt haben, der Schanz also mit dem Hund wedelt?
Kommentar veröffentlichen